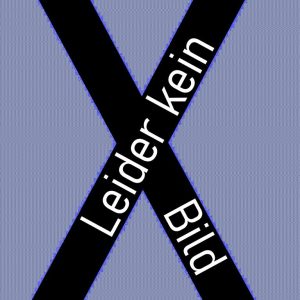Bisher beruhte Datenspeicherung auf der Bewegung oder Ladung von Elektronen in Halbleitern oder magnetischen Domänen. Mit der fortschreitenden Miniaturisierung werden diese Konzepte jedoch ineffizient: Elektronenstreuung, Wärmeverluste und quantenmechanische Effekte führen dazu, dass sich Speicherzellen nicht beliebig verkleinern lassen. Hier setzt die Spintronik an, die den Spin – also den Eigendrehimpuls der Elektronen – als Träger von Information nutzt. Statt mit der Position oder Anwesenheit eines Elektrons wird die Richtung seines magnetischen Moments als logischer Zustand interpretiert. Diese Methode ermöglicht Speicherkonzepte, bei denen Informationen stabiler, dichter und energieärmer gespeichert werden können.
Bisher konnten Skyrmionen – mikroskopische magnetische Wirbelstrukturen – nur in flachen, zweidimensionalen Schichten erzeugt und stabilisiert werden. Diese Skyrmionen zeigen eine einheitliche Chiralität: Sie drehen sich in einer vorgegebenen Richtung, wodurch ihre Beweglichkeit vorhersagbar, aber begrenzt ist. Die Arbeitsgruppe um die Johannes Gutenberg-Universität Mainz und das Forschungszentrum Jülich hat nun erstmals demonstriert, dass sich in synthetischen Antiferromagneten sogenannte Skyrmionenröhren bilden lassen. Diese Strukturen sind nicht einfach verlängerte Versionen zweidimensionaler Skyrmionen, sondern besitzen eine interne Verdrehung, die entlang der Achse variiert. Diese räumlich differenzierte Bewegung – eine Art magnetische Torsion – erlaubt es, innerhalb einer einzigen Nanostruktur mehrere stabile Zustände zu realisieren.
Experimentell wurde dieser Nachweis durch den Einsatz hochauflösender bildgebender Verfahren erbracht, unter anderem mittels resonanter weicher Röntgenstreuung an Anlagen wie BESSY II oder der Swiss Light Source. Die dabei erzielte räumliche Auflösung im Nanometerbereich machte es möglich, die dreidimensionale Magnetstruktur direkt zu visualisieren und deren Dynamik unter unterschiedlichen externen Bedingungen zu verfolgen. Entscheidend ist dabei, dass synthetische Antiferromagneten – Schichtsysteme aus ferromagnetischen Lagen, die über dünne Zwischenschichten antiferromagnetisch gekoppelt sind – kaum externe Streufelder erzeugen. Dadurch sind sie prädestiniert für hochdichte Speicherarrays, in denen einzelne Elemente eng nebeneinander liegen, ohne sich gegenseitig zu stören.
In neuromorphen Architekturen, die darauf abzielen, biologische Gehirnprozesse elektronisch nachzubilden, könnten Skyrmionenröhren als analoge Repräsentationen neuronaler Zustände fungieren. Ihre Fähigkeit, mehrere interne Freiheitsgrade zu kombinieren – Position, Chiralität, Verdrehung – eröffnet theoretische Möglichkeiten für komplexe, lernfähige Systeme. Gleichzeitig lassen sich solche topologisch stabilen Strukturen potenziell für Quanteninformationsprozesse nutzen, da sie gegen Störfluktuationen robust sind und sich präzise manipulieren lassen. Praktische Anwendungen sind jedoch noch weit enrfernet.
Schlagwörter: Johannes Gutenberg-Universität Mainz + Jülich + Skyrmionen
(pz)