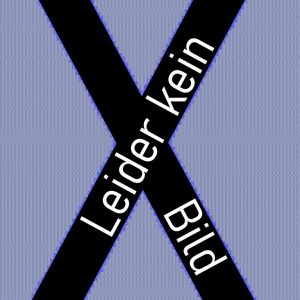Die Europäische Union steht vor einer zunehmenden Herausforderung: einem akuten Personalmangel in ihren Behörden. Dieser Mangel, besonders spürbar im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), der IT-Sicherheit und der Künstlichen Intelligenz (KI), stellt eine erhebliche Gefahr für die Handlungsfähigkeit der EU dar. Ein bereits stattgefundener Personalabbau von fünf Prozent in den vergangenen Jahren hat die ohnehin komplexe Lage zusätzlich verschärft. Die unmittelbar auftretenden Anforderungen, die durch die Corona-Pandemie, Kriege und neue regulatorische Pflichten verstärkt wurden, sind mit dem vorhandenen Personalbestand nicht mehr ausreichend zu bewältigen. Hinzu kommt ein geändertes geopolitisches und wirtschaftliches Umfeld, das umfangreiche neue Aufgabenfelder eröffnet, die oft spezifisches Fachwissen erfordern. Interne Anpassungen reichen für diese Herausforderungen nicht aus. Die EU-Kommission konfrontiert die Mitgliedstaaten mit einem dringenden Bedarf an neuen Mitarbeitern: Für die kommenden drei Jahre fordert sie insgesamt 2.500 zusätzliche Vollzeitäquivalente in ihren Behörden. Nur durch eine schrittweise und kontinuierliche Einstellung eines ausreichenden Personals in den kommenden Jahren kann gewährleistet werden, dass laufende Programme ordnungsgemäß fortgeführt und neue Initiativen effizient vorangetrieben werden. Parallel dazu verfolgt die Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen ein Ziel: die Reduktion von Bürokratie und die Vereinfachung der Umsetzung von Vorschriften, wie beispielsweise der KI-Verordnung. Durch gezielte Vereinfachungsprogramme und die Reduzierung der Programmzahl sollen Überschneidungen minimiert und Effizienzgewinne erzielt werden. Um diese Ziele zu erreichen und die EU zukünftig zukunftsfähig zu gestalten, werden Investitionen in IT, insbesondere in KI-Werkzeuge, als zentraler Faktor angesehen. Dies betrifft nicht nur den Ausbau von IT-Infrastrukturen, sondern auch die Förderung von KI-Anwendungen zur effektiven Bewältigung komplexer Herausforderungen. Eine solche Digitalisierung soll die Effizienz und Handlungsfähigkeit der EU stärken. Die geforderte Finanzierung für diese ambitionierten Pläne erfolgt über einen Zeitraum von sieben Jahren und summiert sich auf 1,26 Prozent des Bruttonationaleinkommens der EU im Durchschnitt der Jahre 2028 und 2034, was einer Gesamtsumme von 1,2 Billionen Euro entspricht – ein Anstieg gegenüber den zuvor gültigen 1,2 Billionen Euro. Diese Finanzierung soll durch eine Steuer auf Elektroschrott ermöglicht werden, während eine Digitalabgabe nicht in Planung ist. Die geforderte Finanzsumme stößt jedoch bei mehreren Mitgliedstaaten auf Widerstand, darunter auch Deutschland, dessen Bundeskanzler Friedrich Merz die Etaterhöhung ablehnt. Dieser Konflikt verdeutlicht die komplexen politischen und wirtschaftlichen Faktoren, die die Zukunft der EU und ihre Fähigkeit zur effektiven Handlungsfähigkeit beeinflussen.
Schlagwörter: EU + IKT + KI
Wie bewerten Sie den Schreibstil des Artikels?